SEHENSWÜRDIGKEITEN
BEDEUTENDE ÖFFENTLICHE GEBÄUDE
DER BAHNHOF
ZURÜCK ZUR AUFLISTUNG
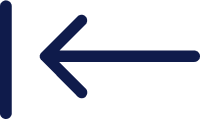
Der Bahnhof
Das ursprüngliche Gebäude wurde im 2. Weltkrieg zerstört und später durch einen funktionalistischen Neubau ersetzt.
1863-1864 unter Leitung des Münchner Ostbahndirektionsarchitekten H. v. Hügel erbaut. Gegen 1900 großzügig erweitert. 1945 durch Fliegerangriff zerstört. Durchgangsbahnhof. Drei gleisparallel angeordnete, dreistöckige Rechteckbauten im Rundbogenstil durch Zwischentrakte mit vorgelagertem Gang verbunden. Mittig vorgelagertes Hauptgebäude um 1900. im Stil der Neurenaissance florentinischer Prägung. Ein Mittelblock mit kubischen Eckpavillons und zurückgesetzten Flankenbauten. Die Schalterhalle tonnengewölbt mit großem, dreigeteiltem Thermenfenster und Oberlicht. Zurückhaltend flächiger Ornamentschmuck. Das Aufnahmegebäude umfasste drei Postlokalitäten, fünf Zollabfertigungsräume, 29 Verwaltungsräume, drei große Wartesäle und einen Speisesaal. Im 1. Stock befanden sich 80 Wohnräume.
(Kunst 1992,594)
Mehr anzeigen


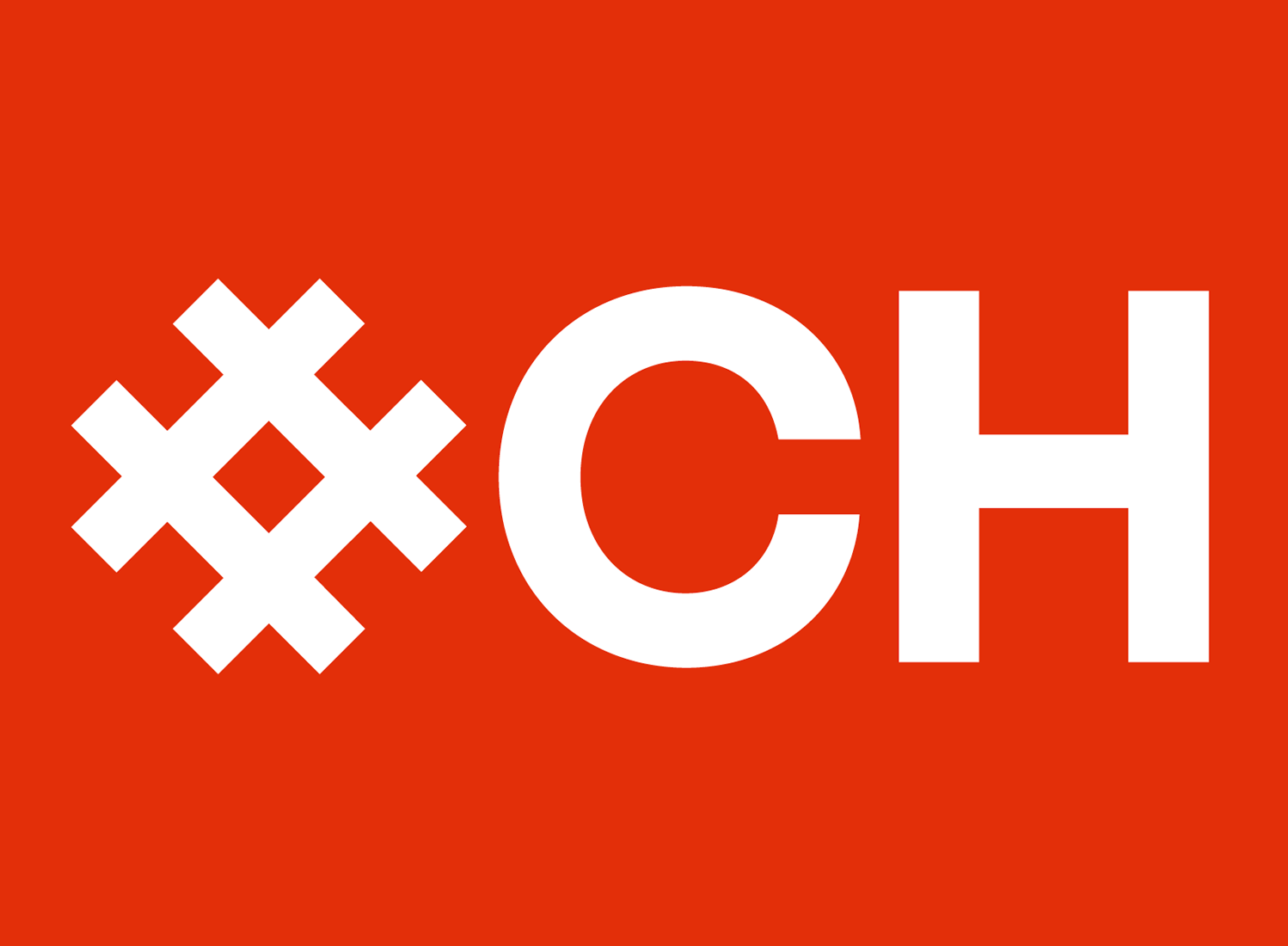 OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
 TOURISTISCHES INFOZENTRUM
TOURISTISCHES INFOZENTRUM
 HISTORISCHE EGER STIFTUNG
HISTORISCHE EGER STIFTUNG

 KULTURZENTRUM SVOBODA
KULTURZENTRUM SVOBODA
 WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
 STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU
STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU

