SEHENSWÜRDIGKEITEN
BEDEUTENDE ÖFFENTLICHE GEBÄUDE
GYMNASIUM
ZURÜCK ZUR AUFLISTUNG
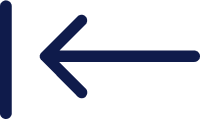
Gymnasium
Das Egerer Gymnasium war aus der alten, schon um 1300 urkundlich erwähnten Lateinschule hervorgegangen und stellte nun, um 1800, einen nicht unbedeutenden wirtschaftlichen Faktor für die Stadt dar, da viele auswärtige Schüler das Gymnasium besuchten und bei Egerer Bürgern Kost und Logis nahmen.
Die Lateinschule war anfangs mit der Niklaskirche eng verbunden gewesen, ihre Lehrer wurden vom Deutschritterorden und dem Domscholasticus der Regensburger Kirche angestellt. Aber bald, im 15. Jahrhundert, erhielt der Rat der Stadt ein Mitbestimmungsrecht bei der Aufnahme von Lehrkräften, das sich im Laufe der Zeit zum alleinigen Aufsichtsrecht über das Schulwesen wandelte.
Das alte Gebäude der Lateinschule wurde im Laufe der Zeit wiederholt umgebaut. 1821 nahm Goethe an der Schlussprüfung der Schüler teil und zeichnete die besten Schüler selbst aus. Das Schulhaus wurde 1822 abgerissen.
Die Lateinschule hatte im 16. Jahrhundert vier bis fünf Klassen mit insgesamt fünf Lehrkräften. 1628 wurde die Schule geschlossen und von der Reformationskommission die Entlassung der evangelischen Lehrer verfügt. 1629 durfte dann die Schule wieder eröffnet werden, zweiklassig und mit nur zwei Lehrern, unter Leitung der Jesuiten (bis 1773). Deren Ziel war die Aufstockung der Schule auf sechs Klassen, die auch wirklich schon 1641 erreicht war. Oberste Lernziele waren eine religiös-theologische Ausbildung und die Erlernung der lateinischen Sprache.
Nach der Auflösung des Jesuitenordens übernahmen die Piaristen die Aufsicht über die Egerer Lateinschule (1774) und erweiterten den Lehrplan um Geschichte, Geographie, Naturkunde, Mathematik und Griechisch. Die Unterrichtssprache war nun nicht mehr Lateinisch, sondern Deutsch. 1850 wurde das Gymnasium zu einer achtklassigen Lehranstalt erweitert, die im Laufe der Zeit immer mehr realistisch-technische Fächer einführte, im Grunde aber stets streng humanistisch ausgerichtet blieb.
(Katalog 1994,82)
Mehr anzeigen


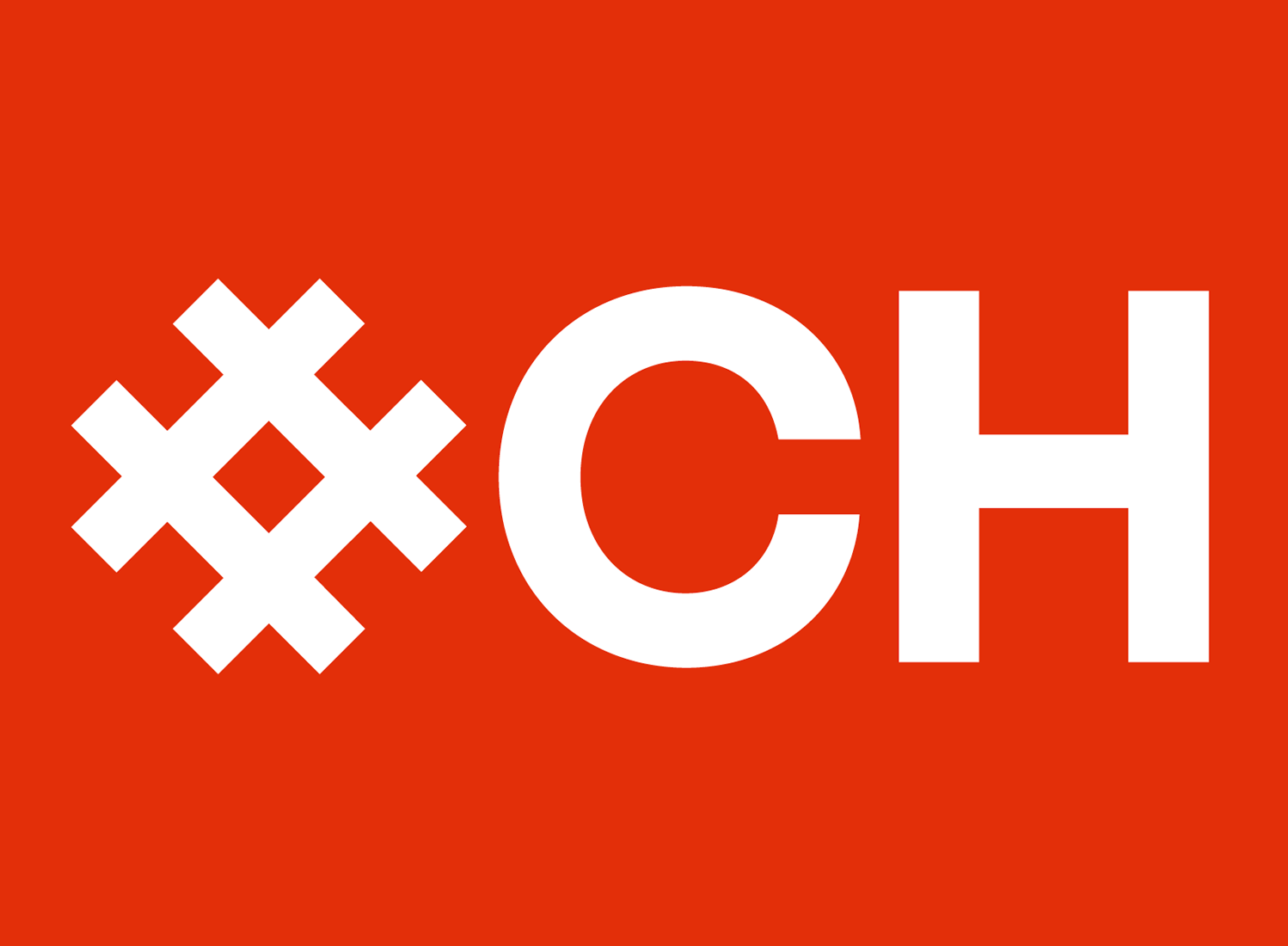 OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
 TOURISTISCHES INFOZENTRUM
TOURISTISCHES INFOZENTRUM
 HISTORISCHE EGER STIFTUNG
HISTORISCHE EGER STIFTUNG

 KULTURZENTRUM SVOBODA
KULTURZENTRUM SVOBODA
 WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
 STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU
STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU

