EJ 1912
Der Bau der neuen Wasserleitung
Wegen des herrschenden Wassermangels und des ungenügenden Wasserdruckes in den neuerbauten, höher gelegenen Teilen der Stadt mußte die Stadt Eger für diese höher gelegenen Teile der Stadt bei der tiefen Lage der Reservoire der bestehenden Wasserleitung ein neues Quellgebiet erschließen und zum Zwecke der Versorgung dieser Stadtteile eine neue Wasserleitung anlegen, an deren Errichtung gegenwärtig gearbeitet wird.
Zu dieser Wasserversorgung war nur das Schwalbenmühlgebiet und ein über der Wasserscheide liegendes Gebiet in den bayerischen Gemeinden Münchenreuth und Pechtnersreuth geeignet. Aus dem Besitze der Stadt konnte nur das Wasser des sogenannten Kuhstalltales in der Gemeinde Oberkunreuth benützt werden, sowie aus dem Buchbrunnrevier die sogenannte Brandelwiese, der Silberbruch und die Pfalzhauquelle. Das übrige Wasser wurde aus den der Stadtgemeinde Eger gehörigen und in Bayern liegenden Wiesen und aus dem königlich bayerischen Staate zugewiesenen Quellen des Schirndinger Reviers sind ein Tauschwasser, für das von der Stadt Eger an die Stadt Tirschenreuth abgegebene Wasser aus dem städtischen Reviere Hochwald-Tillen. Die über der Wasserscheide in den Gemeinden Münchenreuth und Pechtnersreuth gefassten Quellen sind ebenfalls ein Tauschwasser für das von der Stadt Eger an Waldsassen im Reviere Neualbenreuth-Breitenbrunn abgegebene Quellwasser. Die sogenannte Ploßquelle hat die Stadtgemeinde Eger vom Besitzer Ploß in Waldsassen käuflich erworben. Der Heiligenbrunn wurde von der Stadt Waldsassen vom königlich bayerischen Forstärar für die Stadt Eger erworben. Diese besonders hochliegenden Quellen werden über die Wasserscheide zwischen dem Buchbrunnbache und der Veißnitz durch einen an der höchsten Stelle der Leitungsstrecke 200 Meter langen und vier Meter tiefen Durchstich geleitet und beim Buchbrunnen mit der Buchbrunngruppe, die wiederum aus dem Buchbrunnen, den Quellen der Zintelwiese und einer im königlich bayerischen Staatswalde gelegenen Quelle besteht, vereinigt und bis zur Druckkamer bei der sogenannten Brandelwiese geleitet.
Vom königlich bayerischen Forstärar wurde eine Wasserentnahmestelle beim Buchbrunnen vorgeschrieben und ist diese Entnahmestelle auch schon mit Rücksicht auf die vielen Touristen, die dieses idyllische Fleckchen zum Ziele ihrer Wanderung machen, geboten. Es wurde genau an der Stelle des ehemaligen Buchbrunnens eine Quellstube mit Aufbau, die unser Bild zeigt, errichtet, in der ein automatischer Auslauf Wasser zum Trinken spendet. Dieses Wasser ist jedoch nicht direkt vom Buchbrunnen, sondern aus der über der Wasserscheide herübergeführten Leitung.
In die Druckkammer bei der Brandelwiese fließen noch die Quellen von den städtischen langen Wiesen aus der Richtung der sogenannten „dicken Tanne“. Die Ableitung von der Druckkammer dieser großen Gesamtgruppe erfolgt bis zur Einmündung des Kuhstallteiles am Schwalbenmühlbache. An dieser Stelle wird auch die Kuhstalleitung eingeführt. Die vereinigten Leitungen werden nun in 30 cm lichtweiten Gußrohren bei der Schwalbenmühle vorüber durch das Dorf Unterkunreuth um den Grünberg herum bis zum Hochbehälter bei der sogenannten „Mutter Anna“ an der Oberpilmersreuther Straße geführt. Dieser Hochbehälter hat eine Höhenlage von 521 Meter über dem Meer, sodass er noch um 10 Meter höher als der höchste Punkt des Spittelberges und um 12 Meter höher als die sogenannte Fischerkapelle an der Wieser Straße liegt. Durch diese Höhenlage ist eine Wasserversorgung sämtlicher höher gelegenen Punkte der Stadt und der weiteren Umgebung Egers gesichert. Der Hochbehälter fasst 1 500 Kubikmeter Wasser und ist somit in diesem Raume eine größere Wassermenge eingeschlossen, als sämtliche Behälter der heutigen Wasserleitungen zusammengenommen fassen. Diese Wasserleitung kann auch in der Zukunft durch Einbeziehung mehrer hochgelegener Quellen, oder durch Heben weiterer im Besitze der Stadt befindlicher tiefer gelegener Quellen vergrößert werden, sodass auf einen Zeitraum von 50 Jahren, den Maßstab der derzeitigen Vergrößerungen der Stadt Eger vorausgesetzt, Vorsorge für die Wasserversorgung getroffen ist.
Die Quellenfassungen und Quellenleitungen wurden von der Stadt Eger bis zu den Druckkammern in eigener Regie durchgeführt. Die Rohrlegung von den Druckkammern bis zum Hochbehälter und der Bau des Hochbehälters selber, sowie die Zuleitung bis zur Stadt wurde an die Baufirma Adolf Niklas in Teplitz im Akkordwege vergeben. Die Baukosten werden zusammen voraussichtlich 600 000 K betragen. Das Überreich des Hochbehälters führt zu dem derzeitigen oberen Reservoir und wird dadurch das abfließende unverbrauchte Wasser an die bestehenden unteren Zonen abgegeben. Außerdem wird die Schieberanlage in der Stadt derartig gestellt werden, dass zu Zeiten des besonderen Gebrauches oder der Gefahr der Hochdruck in alle übrigen Leitungen geführt werden kann. Die Ergiebigkeit der erschlossenen Quellen ist trotz der acht Monate langen regenlosen Zeit des heurigen Jahres immer noch eine bedeutende, die Güte des Wassers eine einwandfreie und wird die Stadt Eger nach der Eröffnung dieser Wasserleitung über ein kostbares, tadelloses Trinkwasser verfügen. Da das erschlossene Quellwasser, wie jedes andere Wasser in unseren Gegenden, ziemlich kohlensäurehaltig ist, so sind eigene Enteisungsanlagen vorgesehen, um das Anockern der Leitungsrohre zu verhindern.
Durch das Drängen der Bewohner der Dillenberg- und Sandstraße, sowie durch das neuerbaute Krankenhaus wurde die Inangriffnahme des Wasserleitungsbaues bereits im Jahre 1910 dringend. Da die Vereinbarungen mit dem königlich bayerischen Forstärar und mit dem Wasserversorgungsbureau in München wegen der Entschädigung der bayerischen Müller noch nicht vollends abgeschlossen waren, so konnte Ende November 1910 bloß mit den Quellfassungen im Kuhstalltale begonnen werden. Die Quellfassungen beim Buchbrunnen, der Zintelwiese und der sogenannten Langenwiese wurden zu Anfang des Jahres 1911 begonnen und im Juli vollendet. Zu diesem Zeitpunkte waren auch die Verhandlungen in Bayern soweit gediehen, dass mit dem Erschließen der Quelle des Heiligenbrunnens und der Ploßquelle begonnen werden konnte. Durch die Rekurse der am Schwalbenmühlbache interessierten Müller erfuhr auch die Bauausschreibung für die Vergabe der Arbeiten der Rohrleitung und des Hochbehälters eine Verzögerung.
Ebenso wurde durch die Erneuerung des Gemeindeausschusses die Bauführung um einige Monate verzögert, sodass erst Ende September 1911 mit den eigentlichen Rohrleitungen und dem Reservoirbaue begonnen werden konnte. Von der bevorstehenden Witterung hängt es natürlich ab, ob der Wasserbehälter in diesem Winter noch vollends erbaut werden kann, oder ob nach Vollendung des Zuleitungsstranges die bestehende Wasserleitung mit dieser neuen Wasserleitung vereinigt werden kann, ohne den in Bau begriffenen Hochbehälter vorzeitig zu benützen. Nach dieser Voraussicht wird Mitte Jänner 1912 das Wasser der neuen Wasserleitung bereits in das Rohrnetz der Stadt eingeführt werden können. Auf alle Fälle wird Ende Mai 1912 die gesamte Leitung vollendet sein.
Von der Größe dieser Wasserleitung kann man sich ungefähr einen Begriff machen, wenn man bedenkt, daß die letzte äußerste Quelle von der Stadt, gemessen in der Luftlinie, eine Entfernung von neun Kilometern hat, die jedoch durch die Umwege, die die Leitung nehmen muss, auf 14 Kilometer sich vergrößert. Die gesamten Quellen entspringen einem neun Quadratkilometer umfassenden Waldgebiete, dessen Abflüsse größtenteils nach Norden gerichtet sind und mit Ausnahme der Kuhstalltales eine sanfte Neigung besitzen. Die Höhenlage der höchsten Quelle, des sogenannten Bäumlbrunnens, der eineinhalb Kilometer von der Wallfahrtskirche Kappel in nördlicher Richtung liegt, beträgt 586 Meter über dem Meere, während der Buchbrunnen 545 und die Druckkammern eine Höhenlage von 535 Metern haben. Der Bahnhof in Eger hat die Kote 463, die Straße in der Mitte vor dem neuen Krankenhause hat die Kote 486, der obere Marktplatz beim Kaiser Josef-Denkmal 455.5Meter, sodaß die höchste Quelle um 130 Meter höher als der obere Marktplatz liegt.
Nach der Fertigstellung dieser Wasserleitung sind somit alle Wasserkalamitäten in Eger vollständig behoben.
(EJ 1912,261-4)
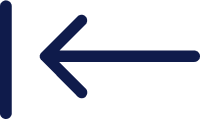

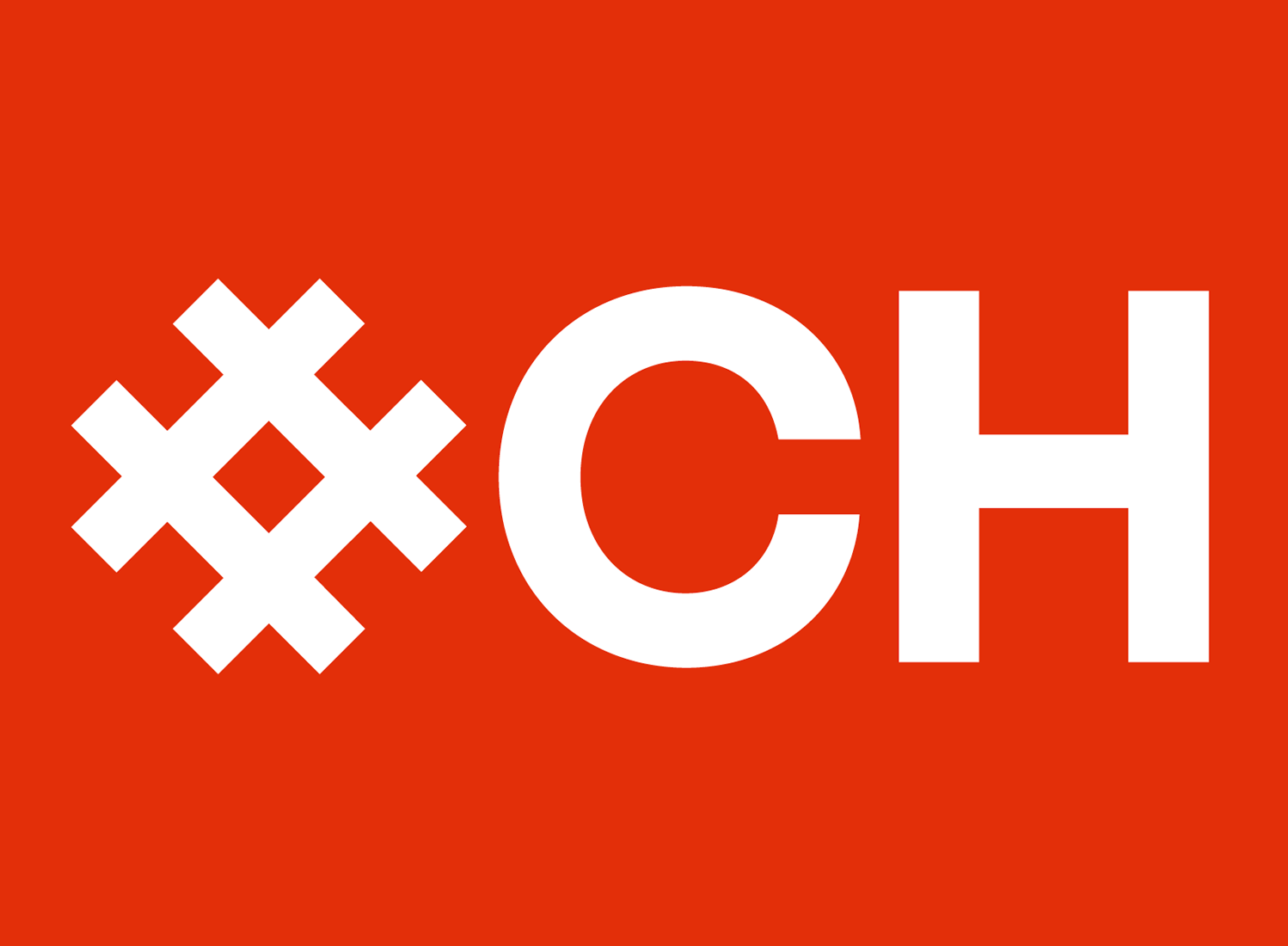 OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
 TOURISTISCHES INFOZENTRUM
TOURISTISCHES INFOZENTRUM
 HISTORISCHE EGER STIFTUNG
HISTORISCHE EGER STIFTUNG

 KULTURZENTRUM SVOBODA
KULTURZENTRUM SVOBODA
 WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
 STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU
STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU


