Siegl 1911
Zur Geschichte des Egerer Krankenhauses
Das allgemeine Krankenhaus vor dem Schifftor erwies sich aber in den letzten Dezennien als unzulänglich und bezüglich der Lage und Einrichtung auch den modernen hygienischen Anforderungen nicht mehr entsprechend. Es wurden daher in den letzten Jahren von Seite der Bezirksvertretung und der Stadtgemeinde Eger mit den Staats- und Landesbehörden wiederholt Verhandlungen wegen Erbauung eines neuen Krankenhauses gepflogen; aber alle Bemühungen, von Seite des Staates oder des Landes eine Subvention zu erlangen, blieben erfolglos und Stadt und Bezirk Eger sahen sich unter Mithilfe der Egerer Sparkasse schließlich genötigt, die Erbauung eines neuen Krankenhauses selbst in Angriff zu nehmen.
Nach mehreren Verhandlungen zwischen dem Gemeindeausschusse, der Bezirksvertretung und der Direktion der Egerer Sparkasse ward das Projekt eines Neubaus gesichert und ein aus den Herren Bezirksobmann Kaspar Krämling, Bürgermeister Dr. Gustav Gschier und dem Direktor der Egerer Sparkasse Dr. Josef Karg bestehendes, vorbereitendes Komitee beauftragte Anfangs 1905 das Stadtbauamt, die Pläne und Kostenvoranschläge für ein neues Krankenhaus, das vor dem Obertor, hinter den Landwehrkasernen errichtet werden sollte, auszuarbeiten. Herr Stadtbaurat Ing. Josef Pascher legte im Oktober 1906 diese Pläne und Kostenvoranschäge dem Komitee vor und bezifferte sich nach diesen Arbeiten der Gesamtaufwand für ein neues Krankenhaus auf 830 000 Kronen.
In der Sitzung der Bezirksvertretung und des Gemeindeausschusses vom 15. Juli 1908 wurde dann die Durchführung des Neubaues nach den vorgelegten Plänen in eigener Regie beschlossen und die Ueberwachung einem Bauausschusse übertragen, zu dem durch Wahl die Herren Bezirksobmann Kaspar Krämling, Bürgermeister Dr. Gustav Gschier, Sparkassedirektor Dr. Josef Karg, ferner drei Mitglieder der Bezirksvertretung, und zwar die Herren Ingenieur Johann Siegl, Rechtsanwalt Dr. Kaspar Tippmann und kais. Rat Bürgermeistr Gustav Wiedermann in Franzensbad und drei Mitglieder aus der Gemeindevertretung, und zwar die Herren Baumeister Ignaz König, Bergdirektor Friedrich Scherb und Primararzt Med. Dr. Christof Heitzer berufen wurden. In derselben Sitzung wurde auch die ganze Bauleitung dem städtischen Baumeister Josef Thurner übertragen.
Noch im August 1908 wurde mit dem Baue des neuen Krankenhauses begonnen und zwar nach dem Beschlusse des Bauausschusses zunächst mit der Aufführung des Wirtschaftsgebäudes und des Infektionsgebäudes, welche beide Gebäude noch in diesem Jahre unter Dach gebracht wurden.
In derselben Zeit wurde auch noch der gesamte Erdaushub für das Hauptgebäude durchgeführt und das Kellergeschoß desselben vollendet, ferner auch noch die Zuleitung des Wassers in der Landwehrstraße und die Kanalisation des ganzen Grundkomplexes in Angriff genommen, welch letztere der Firma N. Rella & Neffe in Wien übertragen war.
Während des Winters 1908/09 erfolgte die Zufuhr des Ziegel-Materiales, wobei die a. priv. Buschtiehrader Eisenbahn auf ihren Linien einen 66%igen Nachlaß gewährte, wodurch ein Ersparnis von nahezu 6000 K erzielt wurde.
Ebenso wurde in diesem Winter noch das gesamte Gerüstholz und alle zum Weiterbau nötigen Werkzeuge und Materialien von der Bauleitung beigeschafft und über das Matratzen wurden in eigener Regie erzeugt, Überzüge und Wäsche in Egerer Geschäften angekauft.
In jedem der 3 Geschosse befindet sich auch ein Ordinationszimmer und zwar zu ebener Erde für chirurgische Fälle, im ersten Stockwerke zur Aufnahme von Kranken, die mit inneren und im zweiten Stockwerke von solchen, die mit Augen-, Ohren-, Haut- und Geschlechtskrankheiten behaftet sind.
In jedem Geschosse befinden sich ferner vier mit Zimbriawannen und Fayencewaschtischen eingerichtete Baderäume, zwei Trinkbrunnen, eine fahrbare Badewanne, und zahlreiche fahrbare Waschtische. Jede Wasserstelle liefert kaltes und warmes Wasser.
Außerdem sind im ersten und zweiten Stockwerke je zwei Tagräume zum Aufenthalte für die Kranken eingerichtet und Wohnräume mit je 2 Zimmern für zwei Sekundärärzte geschaffen.
Mehr als ausreichend ist gesorgt für die Entlüftung sämtlicher Räume. Diese erfolgt einmal durch aufklappbare Oberlichten in sämtlichen Fenstern, außerdem durch die in der Heizanlage eingebauten Sirokko-Ventilatoren. Durch diese wird stets frische Luft aus zwei im Hofraum befindlichen Luftbrunnen zunächst unterirdisch in einen Verteilungsraum eingesaugt, sodann in besonderen Filterbehältern vom Staube gereinigt und in zwei Heizkammern gepresst. Hier wird die Luft erhitzt und angefeuchtet und unter einem bestimmten Drucke durch die unter dem Fußboden liegenden Heißluftkanäle, in welchen Nachwärmekammern eingeschaltet sind, zu den Heißluftschlöten und von diesen in die einzelnen Räume geleitet, wo die Zuströmung durch verstellbare Klappen geregelt werden kann. Auf diese Weise kann innerhalb 20 Minuten die Luft in sämtlichen Räumen zugfrei erneuert werden.
Zur Beheizung des Hauptgebäudes dient außer der beschriebenen Luftheizung noch eine Heißwasserheizung für alle Räume und eine Niederdruckdampfheizung zum raschen Hochheizen der Operationssäle und zur Erwärmung der Kellerräume und der daselbst befindlichen Bäder.
Für die Heißwasserheizung sind im Heizraume drei Gegenstromgliederkessel eingebaut, von denen das heiße Wasser zu den Verteilungsleitungen am Dachboden aussteigt und in abschaltbaren Gruppensträngen wieder zu den Heizkörpern und hierauf zu den Kesseln zurücksinkt. Dabei ist die Bewegung des Wassers eine fortwährend zirkulierende. Außerdem befinden sich im Kesselraum noch zwei Kessel, die für die Niederdruckdampfheizung und die Warmwaserbereitung bestimmt sind.
Die Warmwasseranlage besitzt sowohl im Hauptgebäude, als auch im Wirtschafts- und Infektionsgebäude Rückleitungen, wodurch jederzeit warmes Wasser zugeführt werden kann. Der Kreislauf des Wassers erfolgt hier ebenso wie bei der Heißwasserheizung.
Für die Kaltwasserleitung ist im Garten ein 75 m2 fassender Sammelbehälter aus Beton eingebaut, aus welchem mittelst einer elektrisch betriebenen Pumpe das Wasser in die im Dachraume des Hauptgebäudes aufgestellten schmiedeeisernen Verteilungsbehälter geleitet wird, welche einen Fassungsraum von 17,50 m2 besitzen.
Im Stiegenhause ist ein Personenaufzug und in den angrenzenden Räumen ein Speiseaufzug mit elektrischem Antriebe eingebaut.
Sämtliche Räume sind ausreichend belichtet. Als künstliche Beleuchtung ist für die Krankenzimmer elektrisches Licht vorgesehen.
Um den Kranken auch an der frischen Luft Erholung zu ermöglichen, sind für jede Abteilung und in jedem Geschosse gegen Süden zu offene Liegehallen angebaut. Über diesen Liegehallen ist auch für Sonnenbäder Vorsorge getroffen.
Vom Hauptgebäude aus gelangt man durch einen Verbindungsgang zu dem östlich davon gelegenen einstöckig erbauten 45 Meter langen und 14 Meter tiefen Wirtschaftsgebäude. Im Kellergeschosse daselbst ist wieder eine eigene Heizanlage mit zwei Gegenstromgliederkesseln für Warmwasserbereitung und Dampfheizung und zwar sowohl für das Wirtschaftsgebäude, als auch für das Infektionsgebäude untergebracht, und werden von diesen Kesseln aus auch die Waschküche und die Kochküche mit Dampf und Heißwasser versorgt.
Die im Wirtschaftsgebäude befindliche Waschküche ist von der Kochküche vollkommen getrennt und hat ihren eigenen Eingang. Sie besteht aus einem Uebernahms- und Sortierraum und der eigentlichen Waschküche. In dieser befinden sich drei Einweichbottiche aus Kunststein, ein Laugenkochfaß, ein großes Dampfkochfaß, eine Dampfwaschmaschine, eine große Spülmaschine und eine Zentrifuge und werden die drei letztgenannten Maschinen elektrisch betrieben. Im anstoßenden Trockenraum ist ein fünfteiliger Kulissentrockenapparat und im Mandel- und Bügelzimmer eine elektrisch betriebene Wäschemangel und ein Bügelofen aufgestellt. Außerdem ist noch je ein Zimmer für Näharbeiten und für die Wäscheausgabe bestimmt.- Die ganze Waschkücheneinrichtung wurde von J. H. Bonner in Wien ausgeführt.
In der Kochküche sind sechs Dampfkochapparate mit 90 bis 150 Liter Inhalt für Suppe, Fleisch, Gemüse, Milch und Kaffee und ein Dampfkochtisch mit drei Kipftöpfen mit 25 bis 30 Liter Inhalt aufgestellt. Außerdem befinden sich hier ein Tafelkochherd mit zwei Bratröhren, ein Bratofen mit zwei Röhren und ein Warmsteller für die gekochten Speisen. Warmsteller, Gemüseputzraum und Fleischwaschanlage sind mit Kalt- und Warmwasserleitung, sowie mit den neuesten Spülapparaten ausgestattet. Die Einrichtung dieser Kochküche wurde von den Senkingwerken in Hildesheim besorgt.
Sämtliche Zu- und Rückleitungen zu den Apparaten in beiden Küchen liegen im Kellerraum.
Im Stockwerke des Wirtschaftsgebäudes befinden sich der Betsaal und zehn Zimmer mit Betten für zwanzig Pflegerinnen und vier Mägde, außerdem mehrere Badekabinette, Vorratsräume und Abortanlagen.
Durch einen passierbaren Kanal vom Kellerraum des Wirtschaftsgebäudes aus wird die Dampfleitung, Warmwasserleitung und Kaltwasserleitung in den Kellerraum des Infektionsgebäudes geführt.
In diesem Kellerraum befindet sich auch die Desinfektionsanlage. Der hier aufgestellte Desinfektionsapparat mit Formalinsprayvorrichtung ist derart engerichtet, daß ein Bett, unzerlegt, vollkommen desinfiziert werden kann.
Die Desinfektionsanlage besitzt eine sogenannte unreine Seite zum Empfang der zu desinfizierenden Gegenstände mit besonderem Eingang, Ladestelle, Bad und Abort für den Arbeiter und eine sogenannte reine Seite zur Abgabe der gereinigten Effekten. Zur Dampfentwicklung dient ein eigener stehender Röhrenkessel. In einem im Nebenraume befindlichen Sputumkocher, wohl dem ersten in Oesterreich, werden die Abgänge von Typhuskranken samt den Gefäßen bei 105° Hitze ausgekocht und die sterilisierten Teile durch eine Brause in die Kanalleitung abgeschwemmt.
Diese Anlage wurde von der Apparatebauanstalt in Weimar aufgestellt.
In der südöstlichen Ecke des Grundstückes liegt dann das ebenerdige, 38 Meter lange und 11 bis 15 Meter tiefe Infektionsgebäude und sind hier in zwei besonderen, durch einen Operationssaal voneinander getrennten Abteilungen im ganzen acht Zimmer mit einem Belegraum für zwanzig Kranke eingerichtet. In jeder dieser Abteilungen befindet sich auch ein Wärterzimmer mit Badevorrichtung und eine Teeküche. Dem Haupteingange gegenüber, an der Ostseite, liegt das Ordinationszimmer, während beim Eingange an der Westseite bereits die Anlage für eine Stiege für einen allenfalls später notwendig werdenden Aufbau geschaffen ist.
Die Krankenzimmer in diesem Gebäude erhalten nur elektrische Beleuchtung, während in den Gängen und Nebenräumen neben der elektrischen auch noch Gasbeleuchtung eingerichtet ist. In den Bädern und Teeküchen befindet sich auch hier eine Kalt- und eine Warmwasserleitung, während die Auslaufsbrunnen in den Gängen nur kaltes Wasser abgeben.
Nördlich vom Infektionsgebäude befindet sich das Leichenhaus. Dasselbe enthält einen Aufbahrungsraum, eine Leichenkammer mit hierzu gehöriger Einrichtung, ferner einen besonderen Raum für Infektionsleichen, ein Sezierzimmer, einen Geräteraum und eine Abortanlage. Die Leichentische und der Seziertisch ist überdies drehbar und mit einer direkten Entwässerungsanlage versehen, wie auch die Leichenräume und der Sezierraum mit Vorrichtungen für verschiedene Waschungen eingerichtet sind.
Zwischen dem Infektionsgebäude und dem Leichenhause wurde die von der Stadtgemeinde seinerzeit angeschaffte Infektionsbaracke auf einer Sockelmauer wieder aufgestellt und entsprechend eingerichtet. In derselben befinden sich zwei Wärterzimmer, eine Küche und zwei Belegräume für zusammen sechs Betten.
Nach den obigen Ausführungen können also im Hauptgebäude (181), im Infektionshause (20) und in der Infektionsbaracke (6) im ganzen 207 Kranke bequem Aufnahme finden.
Die Einrichtung der Krankenzimmer, der Operationssäle und sonstigen Räume erfolgte nach den Angaben des Primararztes Dr. Christof Heitzer aufgrund seiner in zahlreichen Spitälern des In- und Auslandes gesammelten Erfahrungen. Die Bauleitung und die Ausführung sämtlicher Bauten, sowie die Beschaffung des gesamten Inventars, lag, wie oben erwähnt, in den Händen des städtischen Baubeamten, Baumeister Josef Thurner, der sich mit Umsicht und Geschick seiner großen verantwortungsvollen Aufgabe entledigte.
Die Kosten für den Bau und die Einrichtung des neuen Krankenhauses waren, wie oben erwähnt, auf 830 000 K präliminiert.
Da aber die Heizanlage allein um 30 000 K höher, als im Kostenvoranschlage bestimmt war, vergeben wurde, auch zahlreiche Mehrherstellungen und Mehranschaffungen namentlich bei Einrichtung der Operationssäle, die nicht vorgesehen waren, nachträglich als notwendig sich herausstellten, so konnte die obige Grenze nicht eingehalten werden.
Da im Inventar noch einiges zu ergänzen ist, so läßt sich der Gesamtaufwand noch nicht ziffernmäßig feststellen, doch dürfte er den Betrag von rund 876 000 K nicht übersteigen.
Dieser Aufwand scheint gedeckt:
Durch Widmungen der Egerer Sparkassa
an die Stadtgemeinde zur Erbauung
eines Infektionsspitals und eines neuen
Krankenhauses im Betrage von……………………………………….164 749 K 66h
und von………………………………………………552 K 42h
durch den Beitrag der Stadtgemeinde
Eger für das Freiwerden der der
Stadt Eger bücherlich gehörigen alten
Krankenhausrealitäten vor dem Schifftor im Betrage von …..50 000 K – h
zusammen….215 302 K08h
durch den Beitrag vom Bezirke Eger per ……………………215 302 „ – „
durch die vom Bezirke Eger und der
Stadtgemeinde Eger je 200 000 K zusammen mit…………….. 400 000 „ – „
bei der Egerer Sparkassa aufgenommenen
Darlehen, bezüglich welcher die Egerer Sparkassa
die Amortisierung, Bezirk und Stadt dagegen die
Verzinsung übernommen haben, endlich
durch die für die fruchtbringende Anlegung
der Widmungen der Sparkassa und der
aufgenommenen Darlehen
erzielten Zinsen im Betrage von …. 6.361 „ 96„
zusammen ..836 966 K12 h
so daß sich also gegenüber dem Gesamtkostenaufwande noch ein unbedeckter Rest von ca. 40 000 K ergibt, welcher von den Erbauern des neuen Krankenhauses: Bezirk und Stadt Eger noch aufzubringen ist.
Die neue Krankenhausanlage, die allen modernen Anforderungen, die an eine solche Anstalt gestellt werden, vollauf entspricht und die in solcher Ausdehnung und mit solcher Einrichtung in anderen Städten in der Größe von Eger, wohl kaum wieder zu finden sein wird, ist also einzig und allein durch die Opferwilligkeit von Bezirk und Stadt Eger mit ausgiebiger Unterstützung der allzeit hilfsbereiten Egerer Sparkassa zustande gekommen.
Möge dieses neue Allgemeine Krankenhaus auf ungezählte Jahre hinaus der heilbedürftigen Menschheit eine segensreiche Zufluchtsstätte sein!
(Siegl 1911,135-145)
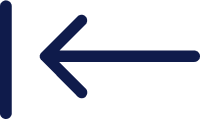


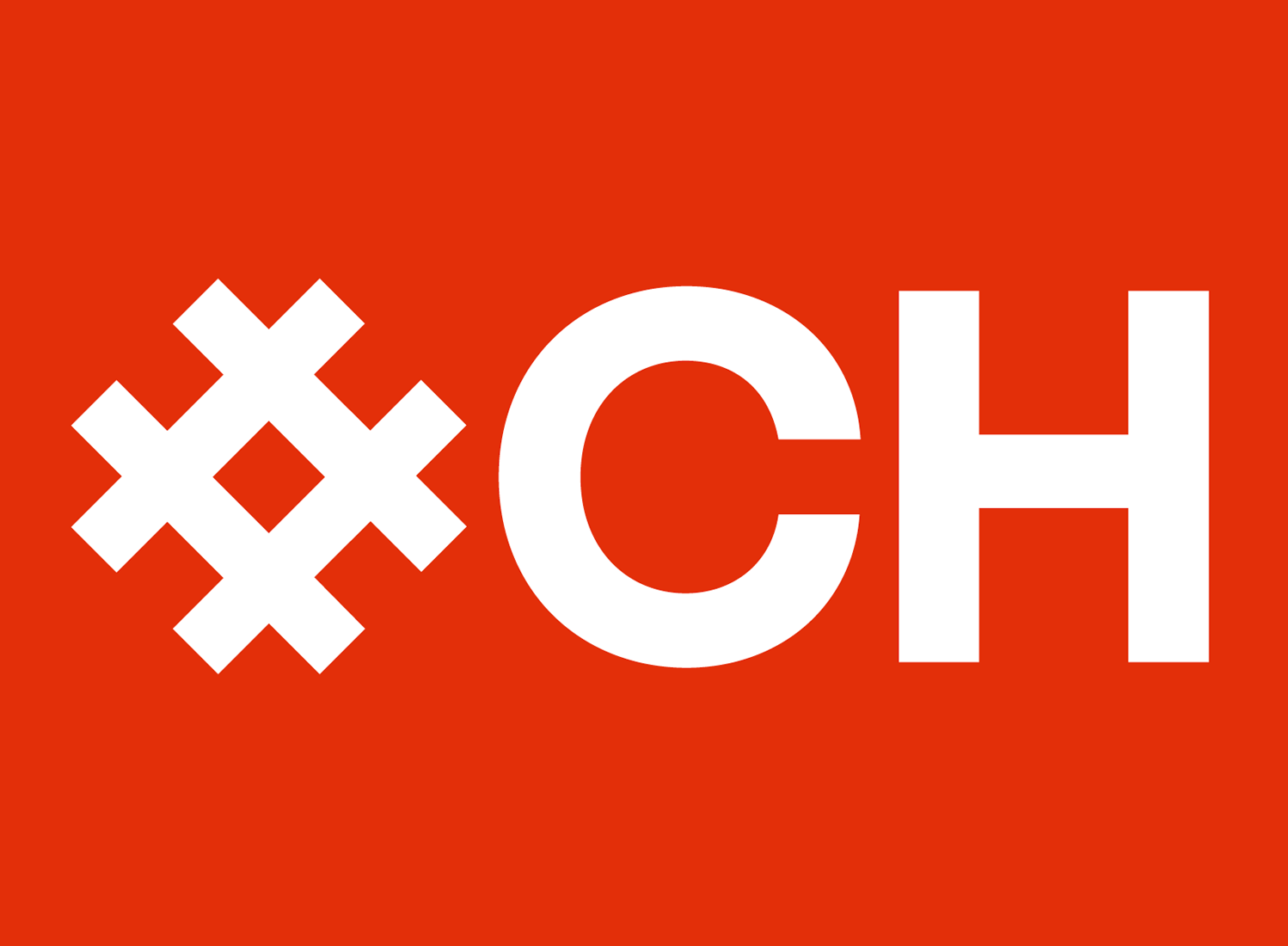 OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
 TOURISTISCHES INFOZENTRUM
TOURISTISCHES INFOZENTRUM
 HISTORISCHE EGER STIFTUNG
HISTORISCHE EGER STIFTUNG

 KULTURZENTRUM SVOBODA
KULTURZENTRUM SVOBODA
 WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
 STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU
STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU

